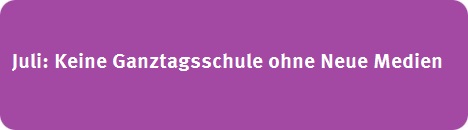Als Einstimmung auf das Beratungsforum „Auf dem Weg zur guten Ganztagsschule“ am 18.5. in Berlin wurden Kristina Krüger (Fachberaterin für den Ganztag) und Marc Rohde (Grundschulleiter) interviewt. Kristina Krüger und Marc Rohde waren als Inputgebende an unterschiedlichen Beratungssalons beteiligt. Für das Portal ganztägig lernen haben sie drei Fragen zu Ihrer Perspektive auf die gute Ganztagsschule beantwortet.
Die gute Ganztagsschule aus Sicht eines Schulleiters
Marc Rohde ist Leiter der Grundschule Hahle in Stade (Niedersachsen). Die Grundschule ist ein Teil des Bildungshauses Hahle. Zum Bildungshaus gehören drei Kitas, eine Kooperationsklasse der Förderschule geistige Entwicklung, die Familienbildungsstätte mit den FezS-Gruppen (Familien erleben zusammen Sprache), die soziale Gruppenarbeit des Jugendamtes in Trägerschaft der Diakonie, die Stiftung Lesen mit dem Konzept „Leseclub“ und eine enge Kooperation mit dem Beratungszentrum für emotionale und soziale Entwicklung. Die Kinder dieser Institutionen arbeiten gemeinsam in den Lernwerkstätten, im Leseclub und gestalten die Mittagspausen gemeinsam. Ziel der verzahnten Angebote ist es zum einen, Kindern eine bruchlose Bildungsbiographie zu ermöglichen, zum anderen Familien zu fördern, um Stigmatisierungen entgegenzuwirken.
Marc Rohde gibt im Beratungssalon 3 (Vielfalt und Bildungsgerechtigkeit an Ganztagsschulen) einen Impuls zum Thema „Bildungschancen gemeinsam mit Partnern fördern – Die Grundschule Hahle als Teil eines Bildungshauses“.
Was macht die gute Ganztagsschule aus?
Gute Ganztagsschule zeichnet sich nach Erfahrung von Marc Rohde durch eine gute Organisation der Lernzeiten, umfassende schulische und nachschulische Betreuungsangebote (inkl. Ferienbetreuung) und inhaltliche Schwerpunktsetzungen aus. Das Mehr an Zeit in der teilgebundenen Ganztagsschule nutzt die Grundschule für eine veränderte Rhythmisierung. Die Stundentafel wurde neu gedacht und längere Lerneinheiten eingeführt.
Bei der inhaltlichen Gestaltung der Lerneinheiten stellt sich das Kollegium immer wieder die Frage: Was brauchen speziell die Kinder unserer Grundschule, um erfolgreich zu lernen? Denn der Migrationsanteil in der Schule ist hoch. Daraufhin haben sich zwei thematische Schwerpunkte herauskristallisiert: die Sprachbildung und die Vermittlung von Methoden des Lernens.
Diese Schwerpunkte spiegeln sich u.a. in den Modulen Sprache und Methoden und in den drei Lernwerkstätten, die die Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte in Kooperation aufgebaut haben, wider: die Lernwerkstatt Musik, die Lernwerkstatt Sprache und die Lernwerkstatt Naturwissenschaften. Die Lernwerkstätten sind nicht nur Ort gezielter Förderung, sondern auch der multiprofessionellen Zusammenarbeit: Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher fördern gemeinsam die Kinder.
Die Elternarbeit spielt in der Grundschule Hahle eine wichtige Rolle. Eltern werden gezielt an bestimmten Elementen des Schullebens beteiligt. Dazu gehören beispielsweise kulinarische Leseabende, Sport- und Spielfeste und Garteneinsätze. Diese Einladungen werden gerne und in großer Zahl angenommen.
Die Qualität der Ganztagsschule Hahle ist zudem geprägt von einem differenzierten Übergangsmanagement. Die Kinder haben die Möglichkeit, vom 3. bis zum 10. Lebensjahr in einem Gebäude und gemeinsamen Lernräumen Erfahrungen zu sammeln und fast ohne Orientierungsschwierigkeiten in Klasse 1 oder im Schulkindergarten zu starten. Das sogenannte „Brückenjahr“ (das Kindergarten-Jahr vor der Einschulung) wird z. B. im Bildungshaus sehr aktiv gelebt, indem die Kita-Kinder in den Schulunterricht eingeladen werden. Auch Eltern können den Unterricht der Kinder kennenlernen und sich mit den Lehrkräften austauschen.
Was sind die größten Herausforderungen der Ganztagsschule?
Ein gemeinsames Verständnis von Bildung und Erziehung zu entwickeln, stellt nach Ansicht von Marc Rohde eine bleibende Herausforderung dar. Im Bildungshaus werden nicht nur verschiedene Professionen, sondern auch Institutionen unter einen Hut gebracht: Kita, Grundschule, Förderschule, Familienbildungsstätte und Beratungszentren. Über die Professionen und Institutionen hinweg eine gemeinsame Vision von guter Bildung zu entwickeln und bereit zu sein, immer wieder neu anzusetzen, ist mühsam, aber gewinnbringend. Das erlebt auch die Schulgemeinschaft der Grundschule Hahle.
Mit einem kleinen Unterstützerkreis zu beginnen und dann mit konkreten Vorschlägen Überzeugungsarbeit in der Breite des Kollegiums zu leisten, ist ein Weg, mit dem Herr Rohde gute Erfahrungen gemacht hat. Demnächst wird so z. B. das bestehende Rhythmisierungskonzept der Schule erneuert.
Was sind die größten Potentiale der Ganztagsschule?
Das Mehr an Zeit hält Marc Rohde für eines der großen Potentiale. Mehr Zeit bedeutet für die Schülerinnen und Schüler, zusätzliche Chancen zu haben, Gelerntes zu wiederholen und Wissen anzuwenden. Vier Stunden in der Woche sind allein dafür in Lern- und Übungszeiten reserviert. Die Schülerinnen und Schüler bekommen hier die Gelegenheit, was sie gelernt haben, direkt und praktisch umzusetzen.

Die gute Ganztagsschule aus Sicht einer Jugendhilfevertreterin
Kristina Krüger beleuchtet das Thema gute Ganztagsschule aus der Perspektive der Jugendhilfe. Sie ist Fachreferentin der Diakonie Hamburg im Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe und zuständig für die Themen Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen und Ganztagsschulen. Frau Krüger ist zudem Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit Hamburg. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Schulen und Fachbehörden und in der Begleitung von Kooperationsprojekten zwischen Jugendhilfe und Schule.
Kristina Krüger gibt im Beratungssalon 4 („Verzahnung von Vor- und Nachmittag und die Zusammenarbeit mit Partnern“) einen Impuls zum Thema „Von der Zusammenarbeit zur Kooperation – Die erfolgreiche Einbindung außerschulischer Partner in den Ganztagsschulalltag“.
Was macht die gute Ganztagsschule aus?
Die gute Ganztagsschule öffnet sich nach Erfahrung von Kristina Krüger für andere und neue Perspektiven. Sie sucht den Dialog mit den verschiedenen Professionen, die Kinder und Jugendliche in ihrem Aufwachsen begleiten. Die verschiedenen Sichtweisen darauf, was Kinder und Jugendliche brauchen und was gute Bildung ist, erkennt sie an und wertschätzt sie.
Sie bietet sich aktiv als Kooperationspartnerin an und tritt dazu mit den verschiedenen Einrichtungen der Jugendhilfe, z.B. der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit oder Jugendverbänden, in Dialog: über den gemeinsamen Bildungsauftrag, über das Kooperationsverständnis, über Erwartungen und Rollenverständnisse.
Die gute Ganztagsschule teilt sich gleichberechtigt die Zuständigkeit für das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen. Sie lässt sich anregen und ist bereit, von der Professionalität der Jugendhilfe, ihren Methoden und Erfahrungen, zu lernen. Sie anerkennt die Jugendhilfe als Partnerin im Prozess, Kindern und Jugendlichen nicht nur Zugang zu formalen Bildungsabschlüssen, sondern auch zu tragfähigen Lebensperspektiven darüber hinaus eröffnen zu können.
Was sind die größten Herausforderungen der Ganztagsschule?
Jungen Menschen einen Schultag zu ermöglichen, den sie für sich selbst als gelungen einschätzen, ist eine der größten Herausforderungen der Ganztagsschule. Damit Schule nicht als Belastung und Vollzeitjob erlebt wird, braucht es daher auch ungestaltete Pausen, pädagogisch unverzweckte Zeiten und Gelegenheiten, Lernorte außerhalb von Schule zu erleben. Daher kann es aus Sicht von Kristina Krüger nicht nur darum gehen, vermeintlich passende Angebote in den Schulalltag zu integrieren, sondern Schulstrukturen zu überdenken, um solche Freiräume zu schaffen.
Zu den Herausforderungen gehört es nach Erfahrung von Kristina Krüger, Kommunikation miteinander zu gestalten. Als gelungenes Beispiel nennt Kristina Krüger SCHOKJA – ein Kooperationsprojekt von Schule und Offener Kinder- und Jugendarbeit. Ziel des Projektes war es, die Stärken von Schule und Jugendhilfe zusammenzuführen. Das zweieinhalbjährige Projekt endete 2016 mit einer Handreichung für die Gestaltung von Kooperationen. Eine der wichtigen und sehr praktischen Erfahrungen des Projektes war es, dass Kooperation Zeit braucht, um Dialoge führen zu können und die Stärken der Partnerinnen und Partner zu verstehen. Wenn es gelingt, gemeinsame Zeit für inhaltliche Auseinandersetzung in die schulischen und Jugendhilfestrukturen zu integrieren, ist eine wichtige Herausforderung gemeistert.
Was sind die größten Potentiale der Ganztagsschule?
Das Potential der Ganztagsschule ist es, jungen Menschen Orte vielfältiger Bildung anbieten zu können: von der kulturellen bis hin zur politischen Bildung, Sport, Spiel und Freizeit gleichermaßen zu integrieren. In Kooperation mit den Jugendhilfepartnern lassen sich die Stärken informeller Bildung über ein Curriculum hinaus nutzen und neue Lernorte außerhalb des Schulgeländes einbeziehen. Damit erhöht Ganztagsschule ihre Akzeptanz, über die Lebensphasen der Schülerinnen und Schüler hinweg.
Die Jugendhilfe fügt dem Ganztag nicht nur eine große Methodenvielfalt hinzu, sondern verändert mit ihren Prinzipien, z.B. dem Prinzip der Freiwilligkeit, die Perspektive auf die Schülerinnen und Schüler. Selbstbestimmung und Selbstbildungsprozesse rücken stärker in den Fokus. Sich selbst Ziele zu setzen und über das eigene Lernen zu bestimmen – das sind Voraussetzungen für gelingende Lebensgestaltung über die Schulzeit hinaus.
Die Öffnung der Ganztagsschule in den Sozialraum erachtet Frau Krüger als Potential, um sich als mitgestaltende Akteurin im Sozialraum anzubieten – z.B. durch die Beteiligung in Stadtteilgremien. Durch diese Form der Beteiligung im Sozialraum haben Ganztagsschulen die Chance, die Lebenssituationen der Schülerinnen und Schüler und ihrer Familien umfassender zu verstehen und auf deren Bedürfnisse im Schulalltag in geeigneter Weise antworten zu können.